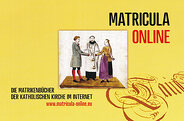Eucharistisches Hochgebet, Teil 1
Wie wir wissen, gibt es in unserem römischen Ritus verschiedene Hochgebete, die auch teils unterschiedlich aufgebaut sind. Da sind einerseits die klassischen vier und daneben noch einige weitere, die zugelassen sind, wie z.B. ein Hochgebet für Gehörlose, die Kinderhochgebete oder ein Hochgebet um Versöhnung. Weiters gibt es in den Ostkirchen viele Traditionen und Hochgebete, sogenannte Anaphoren. Der Begriff des „Eucharistischen Hochgebets“ ist eigentlich erst seit Anfang des 20. Jhd. in Gebrauch, erstmals bei dem Liturgiewissenschaftler Anton Baumstark. Davor sprach man hauptsächlich vom „Canus Romanus“, dem „römischen Kanon“, denn bis 1968 kannte man im römischen Ritus nur ein einziges Hochgebet, das heute als das erste im Messbuch steht. Der römische Kanon Missae wurde ab Papst Gregor dem Großen im 6. Jhd. die verbindliche Richtschnur. In Folge des II. Vatikanischen Konzils gab Paul VI. den Auftrag, zusätzlich zum römischen Kanon zwei bis drei neue Hochgebete zu suchen oder zu schaffen.
Was ist nun das Eucharistische Hochgebet? Nun, es ist, wie der Name schon sagt, v.a. Gebet und Gebet ist es als ganzes. Es ist also primär nicht Verkündigung, wie es Martin Luther aufgefasst hat und auch die Einsetzungsworte „Das ist mein Leib/Das ist mein Blut“ werden gebetet und nicht vorgetragen. Darum hat das Hochgebet, wie christliches Beten generell, eine trinitarische Grundstruktur. Das Gebet richtet sich an den Vater durch den Sohn im Hl. Geist. An manchen Stellen ist es auch an Christus gerichtet. Sodann hat das Hochgebet eine erinnernde und vergegenwärtigende Struktur. Wir gedenken der Heilstaten Gottes, wie es uns Jesus beim Letzten Abendmahl aufgetragen hat: „Tut dies zu meinem Gedächtnis.“ Doch es ist nicht nur ein „Erinnern“, sondern im jüdisch-biblischen Umfeld meint „gedenken“ immer ein Gegenwärtig-Setzen des Gedachten. In diesem Fall wird also Jesu hingegebener Leib und sein Blut real im Hier und Jetzt Gegenwart. Sein Opfer am Kreuz zur Hinwegnahme der Sünde der Welt und zur ganzheitlichen Erlösung des Menschen, das er beim Abendmahl vorausnahm, wird heute in der Hl. Messe Gegenwart. Es hat für uns existenzielle Bedeutung. Wir stehen real unter dem Kreuz Jesu, dessen Opfer in der Messe auf unblutige und sakramental-zeichenhafte Weise gegenwärtig ist und damit immer aktuell bleibt.
Im Hochgebet werden also Brot und Wein zu Leib und Blut Jesu Christi, wobei das ganze Hochgebet diese verwandelnde-konsekratorische Wirkung hat, nicht nur die Einsetzungsworte, auf die man sich in der Scholastik des Mittelalters fixiert hatte, auch wenn diese zentral sind. Darauf hat man sich heute im ökumenischen Dialog geeinigt.
Michael Ungrad