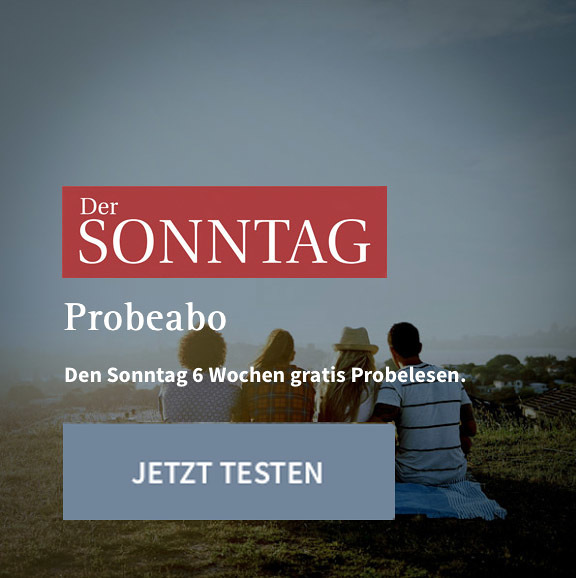Herausforderungen in der Ökumene: MARIA

… in den Dogmen
| Altorientalen |
|
Die Kirchen des Ostens sind die eigentlich marienfreudigen Kirchen. Vieles, was heute wie selbstverständlich als typisch römisch-katholisch gelebt wird, hat seine Quellen in der Marienverehrung der Ostkirche.
Sie begann im 3. Jh., Mariengebete zu formulieren. Hier wurden die Begriffe „immerwährende Jungfrau“, „Gottesgebärerin“ und „Himmelskönigin“ erstmalig gebraucht. Marienlegenden, -feste, -bilder und -kirchen wurden hier ab dem 3. Jh. geschaffen. Zu dieser Zeit war der westliche (römische) Teil der Christen noch ohne marianisches Gedankengut.
|
| Orthodoxe |
|
Für die ostkirchliche Orthodoxie spielt Maria in der Liturgie und in der Heiligenverehrung auf dem Boden der altkirchlichen Bekenntisse der Konzilien von Ephesus und Chalcedon eine große Rolle; ihre Erwählung und Vollendung werden gefeiert, sind aber nicht dogmatisiert.
Die beiden jüngeren Dogmen (Maria ist ohne Erbsünde empfangen/Unbefleckte Empfängnis und Maria ist in den Himmel aufgenommen/Mariä Aufnahme in den Himmel) werden auch im Hinblick auf den Primat des römischen Papstes problematisiert.
|
| Katholiken |
|
Beginnend mit dem Konzil von Ephesus (431), würdigt das kirchliche Lehramt Maria im Rahmen von vier dogmatitschen Formulierungen:
|
| Protestanten |
|
Die Reformatoren äußern Kritik an einer Marienfrömmigkeit, die mit der Heilsbedeutung Christi konkurriert, und lehnen eine unmittelbare Anrufung Mariens ab.
Sie bestreiten deren Begründung in der Hl. Schrift und kritisieren die besonderen Umstände ihrer Anrufung.
Unannehmbar ist aus der Sicht der Reformatoren ein Verfahren, mit dem sich das Lehramt der katholischen Kirche selbst zur Offenbarungsquelle macht.
|
| Anglikaner |
|
Im interkonfessionellen Gespräch zeigt die Anglikanische Kirche (2006) eine bedingte Offenheit auch gegenüber den beiden neueren Mariendogmen (Maria ist ohne Erbsünde empfangen/Unbefleckte Empfängnis und Maria ist in den Himmel aufgenommen/Mariä Aufnahme in den Himmel).
|
... im Bild
| Altorientalen |
|
koptische Ikone
|
| Orthodoxe |
|
griechisch orthodox Maria Panagia ( „die Allheilige“)
|
| Katholiken |
|
Rafael, Madonna Sixtina (Gemäldegalerie Alter Meister, Dresden,)
|
| Protestanten |
|
keine bildhafte Darstellung Marias in der Kirche. im Bild: Shilpa Gupta, (Heat Book), 2009, Karlskirche, Kassel, Germany, 2017
|
| Anglikaner |
|
Lady Chapel (Marienkapelle) in St. Mary in Derby, England |
… in den Gebeten / Hymnen
| Altorientalen |
|
In das 3. Jh. ist ein ägyptisches Papyrusfragment zu datieren, das eine unmittelbare Anrufung der Gottesmutter bezeugt:
|
| Orthodoxe |
|
Die Mariologie in der orthodoxen Kirche ist viel mehr im liturgischen Leben als in der dogmatischen Lehre verankert.
In der Liturgie heißt es nach der Wandlung: „Wir bringen diesen geistlichen Gottesdienst auch dar für die im Glauben Ruhenden, […] vornehmlich für die allheilige, allreine, über alles gesegnete und ruhmreiche Herrin, die Gottesgebärerin und stete Jungfrau Maria.“
In den Litaneien bei der Liturgie heißt es: „Unserer allheiligen, allreinen, über alles gesegneten und ruhmreichen Herrin, der Gottesgebärerin und steten Jungfrau Maria mit allen Heiligen eingedenk, lasset uns einer den anderen und uns selbst und unser ganzes Leben Christus, unseren Gott anempfehlen.“
Auch im „Hymnos Akathistos“ (an Feiertagen der Fastenzeit vor Ostern gesungen) zeigt sich in eindrucksvoller Weise die Marienverehrung in der orthodoxen Kirche.
|
| Katholiken |
|
Maria wird von der Kirche aufgrund ihrer einzigartigen Stellung im Heilswerk ihres Sohnes in besonderer Weise verehrt, nicht aber angebetet. Sie darf um Fürbitte angerufen werden.
Mariengebet der hl. Mutter Teresa:
|
| Protestanten |
|
In den evangelischen (protestantischen) Kirchen wird nicht zu den Heiligen gebetet – auch nicht zu Maria –, weil davon ausgegangen wird, dass jeder Mensch einen direkten Zugang zu Gott hat und dass es keine Heiligen braucht, die die menschlichen Bitten vor Gott bringen müssen.
Der Lobgesang der Maria („Magnificat“) findet sich in mehrfacher Vertonung im „Mein Seel, o Herr, muss loben dich,
|
| Anglikaner |
|
Die römisch-katholische und die anglikanische Kirche beten gemeinsam das Ave Maria: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,
|
… im Festkreis
| Altorientalen |
|
– Fest Verkündigung der Geburt der Jungfrau Maria an ihren Vater, den heiligen Joachim.
|
| Orthodoxe |
|
Außer den Hymnen in den Gottesdiensten und Festen Christi und zu Ehren der Heiligen werden auch eigene Marienfeste gefeiert:
|
| Katholiken |
|
– 4 Hochfeste (25.März und 2.Februar sind „Herrenfeste“) (1. Jänner., 25. März., 15. August., 8. Dezember.)
|
| Protestanten |
|
Die lutherische Kirche kennt traditionell drei Marienfeste, die aber genau genommen Christusfeste sind:
|
| Anglikaner |
|
– The Annunciation of Our Lord to the Blessed Virgin Mary, 25. März
|
Teil 1 der Serie:
katholisch / evangelisch: Was sie verbindet, was sie trennt
Teil 2 der Serie:
Verständnis der Heiligen Schrift
Teil 3 der Serie:
Teil 4 der Serie:
Teil 5 der Serie:
Teil 6 der Serie:
Teil 7 der Serie:
Teil 8 der Serie:
Teil 9 der Serie:
Teil 10 - Ende der Serie
weitere Informationen zu
E-Mail-Adresse: redaktion@dersonntag.at