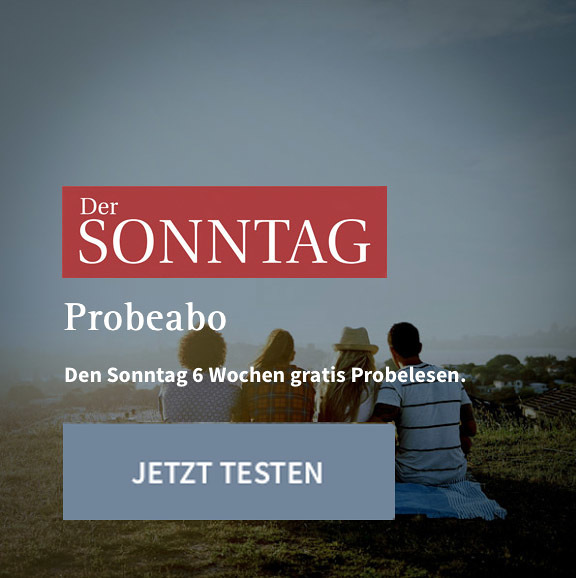Herausforderungen in der Ökumene: GEMEINSCHAFT DER HEILIGEN

Wer ist ein Heiliger, eine Heilige?
Wie wird man ein Heiliger,
eine Heilige?
| Altorientalen |
|
Die Heiligen gehören in allen Ostkirchen zum geistlichen Leben. Die förmliche Heiligsprechung (Kanonisierung) ist Angelegenheit der Leitungsorgane der einzelnen autokephalen (eigenständigen) Kirchen. Voraussetzung für eine Heiligsprechung ist die spontane Verehrung und Anrufung durch das Kirchenvolk.
|
| Orthodoxe |
|
Da die orthodoxe und katholische Kirche etwa 1000 Jahre lang trotz der vorhandenen Spannungen und zeitweiligen Spaltungen im Bewusstsein der Zugehörigkeit innerhalb der einen Kirche Christi gelebt haben, bedeutet das von der Heilslehre ausgehend, dass die großen Heiligen der Kirche aus dieser Zeit auch gemeinsame Heilige sind.
Dazu gehören auch viele Bischöfe und Päpste von Rom, die hochgeschätzt und verehrt werden, eben als Heilige der Kirche Jesu Christi, d. h. auch als Heilige im Festkalender der orthodoxen Kirche bis heute.
|
| Katholiken |
|
Der Ausdruck „die Heiligen“ im Neuen Testament kann einerseits für alle Gläubigen in Christus gebraucht werden, bezieht sich andererseits jedoch auch auf beispielhafte Personen in der Heilsgeschichte.
Historisch lässt sich die Entwicklung der Heiligenverehrung, die Höhen und Tiefen nur schwer in wenigen Zeilen darstellen. Zumindest ist man sich mit anderen Kirchen darüber einig, dass es Vorbilder im Glauben braucht, die nicht abgehoben, sondern ganz konkret ihr Christsein gelebt haben. Einige dieser Gestalten sind über die Kirchengrenzen anerkannt (Nikolaus, Franz von Assisi u. a.).
Die römisch-katholische Kirche praktiziert ein Heiligsprechungsverfahren in mehreren Schritten.
|
| Protestanten |
|
Vom Heiligendienst wird von den Unseren so gelehrt, dass man der Heiligen gedenken soll, damit wir unseren Glauben stärken, wenn wir sehen, wie ihnen Gnade widerfahren und auch wie ihnen durch den Glauben geholfen worden ist; außerdem soll man sich an ihren guten Werken ein Beispiel nehmen, ein jeder in seinem Beruf.
Aus der Heiligen Schrift kann man aber nicht beweisen, dass man die Heiligen anrufen oder Hilfe bei ihnen suchen soll (vgl.1 Tim 2,5).
Christus ist der einzige Heiland, der einzige Hohepriester, Gnadenstuhl und Fürsprecher vor Gott (Röm 8,34). Und er allein hat zugesagt, dass er unser Gebet erhören will … „Wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei Gott, der gerecht ist, Jesus“ (1 Joh 2,1).
|
| Anglikaner |
|
Die 9. Lambeth-Konferenz stellte vier Grundsätze für das ehrende Gedenken (commemoration) der Heiligen auf:
|
Darstellung im Bild
| Altorientalen |
|
Ikonostase
Typisch für koptische Ikonen ist, dass sie nicht das Leiden zeigen, sondern das fröhliche Leben, auch bei den Märtyrern.
|
| Orthodoxe |
|
Prosphoren in der Backstube Die Prosphore muss rund sein und besteht aus zwei Teilen, als Zeichen der zwei Naturen Christi – der göttlichen und menschlichen. Das griechische Wort Proskomidie bedeutet Darbringung. Esi werden aus dem eucharistischen Brot Teile geschnitten und als Mikrokosmos der Gemeinschaft der Heiligen auf die Patene gelegt.
Das 2. Konzil von Nizäa (787) befasste sich vornehmlich mit der Bedeutung der heiligen Ikonen in der Kirche, befürwortete und definierte die Ikonenverehrung bzw. die allgemeine Lehre von den Ikonen.
Heilige sind zur besonderen Fürbitte für die Welt befähigt. Das Konzil bekämpfte dadurch die ikonenfeindliche Politik und Handlung einiger Kaiser zuvor (Ikonoklasmus).
|
| Katholiken |
|
Die „14 Nothelfer“ mit ihren Attributen
Die vierzehn Nothelfer sind vierzehn Heilige aus dem zweiten bis vierten Jahrhundert. Die Gruppe besteht nach der sogenannten Regensburger Normalreihe aus drei weiblichen und elf männlichen Heiligen, wobei alle bis auf den hl. Ägidius als Märtyrer starben.
|
| Protestanten |
|
revidierte Lutherbibel mit Playmobil Luther.
„Wir lehren dass man den wahren Gott allein anbeten und verehren soll … Dabei verachten wir jedoch nicht die göttlichen Heiligen, noch denken wir gering von ihnen. Wir anerkennen, dass sie lebendige Glieder Christi sind, Freunde Gottes, die Fleisch und Welt sieghaft überwunden haben.
Wir lieben sie deshalb wie Brüder und ehren sie auch, allerdings nicht im Sinne göttlicher Verehrung, sondern durch ehrenvolle Wertschätzung und rechtes Lob.“
„Damit aber die Menschen im Glauben unterwiesen und über göttliche Dinge und ihre Seligkeit belehrt würden, hat der Herr befohlen, das Evangelium zu predigen (Mk 16,15), aber nicht zu malen oder mit Malerei das Volk zu lehren; er hat auch die Sakramente eingesetzt, aber nirgends Bilder verordnet.
Wir mögen aber unsere Blicke hinwenden, wohin wir wollen, so begegnen uns lebendige und wahre Geschöpfe Gottes, die, wenn sie beachtet würden, wie es billig wäre, den Betrachter weit mehr ergreifen müssten als alle von Menschen geschaffenen Bilder oder ihre nichtssagenden, unbeweglichen, matten und toten Bildgestalten …“
|
| Anglikaner |
|
|
Der hl. Patrick (17. März) ist der irische Nationalheilige.
Wie werden Heilige verehrt?
| Altorientalen |
|
Die Verehrung der Heiligen äußert sich in allen Ostkirchen
|
| Orthodoxe |
|
Das jährliche Totengedenken wird auch als „dies natalis“ („Hineingeboren-Werden in die Vollendung“) bezeichnet. – Fest Allerheiligen: Acht Tage nach
|
| Katholiken |
|
Die Heiligen werden in der Kirche gemäß der Überlieferung verehrt, ihre echten Reliquien und ihre Bilder in Ehren gehalten. Denn die Feste der Heiligen künden die Wunder Christi in seinen Knechten und bieten den Gläubigen zur Nachahmung willkommene Beispiele.
Die Feste der Heiligen sollen nicht das Übergewicht haben gegenüber den Festen, welche die eigentlichen Heilsmysterien begehen. Eine beträchtliche Anzahl von ihnen möge der Feier in den einzelnen Teilkirchen, Nationen oder Ordensgemeinschaften überlassen bleiben, und nur jene sollen auf die ganze Kirche ausgedehnt werden, die das Gedächtnis solcher Heiligen feiern, die wirklich von allgemeiner Bedeutung sind.
|
| Protestanten |
|
Nach evangelischem Verständnis vollzieht sich das Gedenken der Heiligen allein im Gebet zu Gott:
|
| Anglikaner |
|
Im Kalender sind eine Reihe von Heiligen (vor allem Personen aus dem Neuen Testament) als sogenannte „Holy Days“ verzeichnet.
wird zwischen Märtyrern, Missionaren, Hirten, Theologen, Kirchenlehrern, Mönchen unterschieden. |
Teil 1 der Serie:
katholisch / evangelisch: Was sie verbindet, was sie trennt
Teil 2 der Serie:
Verständnis der Heiligen Schrift
Teil 3 der Serie:
Teil 4 der Serie:
Teil 5 der Serie:
Teil 6 der Serie:
Teil 7 der Serie:
Teil 8 der Serie:
Teil 9 der Serie:
Teil 10 - Ende der Serie
weitere Informationen zu
E-Mail-Adresse: redaktion@dersonntag.at