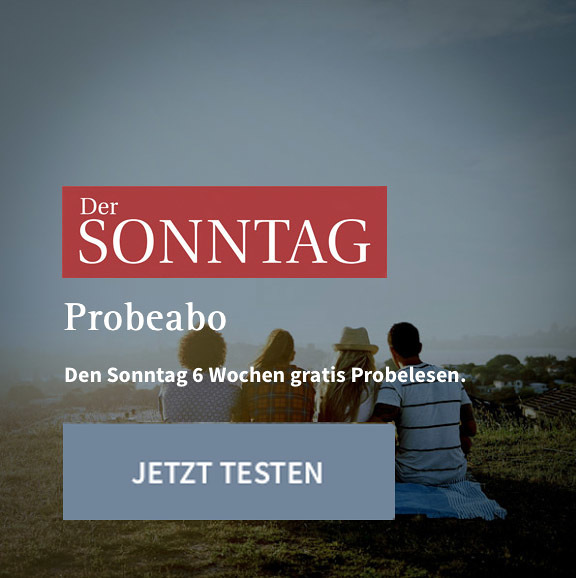Herausforderungen in der Ökumene: DAS OBERHAUPT DER KIRCHE

Was sind die wesentlichen „Knackpunkte“?
| Altorientalen |
|
Es ist wohl zutreffend, dass viele Altorientale den Theologen Joseph Ratzinger (Benedikt XVI.) schätzen, dessen Aussage, dass „Rom vom Osten nicht mehr an Primatslehre verlangen muss, als im ersten Jahrtausend gelehrt und gelebt wurde“, bis heute in ihren Ohren nachklingt.
Die Kirchen sind selbstständig und voneinander unabhängig, stehen jedoch in voller kirchlicher sakramentaler (eucharistischer) Gemeinschaft.
|
| Orthodoxe |
|
Im Unterschied zur katholischen Kirche ist außer einem ökumenischen Konzil kein sichtbares Prinzip der Einheit der universalen Kirche notwendig.
Die ökumenische Diskussion über die Frage des Petrusamtes hat ergeben, dass die orthodoxen Kirchen Rom als „prima sedes“ (Ehrenvorsitz), und den Bischof von Rom als ersten der Bischöfe anerkennen. Sie tun dies aber nicht im Sinn eines Primats der Jurisdiktion, sondern im Anschluss an Ignatius von Antiochien im Sinne eines Vorsitzes in der Liebe.
Johannes Chrysostomus schreibt jedem Bischof das Petrusamt für seine Ortskirche zu.
|
| Katholiken |
|
Papst Paul VI. meinte im Jahr 1967, das „größte Hindernis auf dem Weg zur Ökumene“ sei der Papst selbst.
Das Vatikanum II. hat diese Lehre durch die Stärkung der Bischöfe ergänzt, die mit dem Papst und dem Volk Gottes die volle Gewalt über die Kirche besitzen.
|
| Protestanten |
|
Weil Jesus Christus, als das Wort und durch sein Wort, das eine und einzige Haupt der Kirche ist, lehnen die Kirchengemeinschaften aus der Reformation ein sichtbares Haupt der Kirche ab, wie es aus katholischer Sicht der Bischof von Rom als Nachfolger des Petrus ist.
|
| Anglikaner |
|
Die Sicht auf den Papst ist historisch vom Konflikt mit Heinrich VIII. überschattet. So wurde anfänglich die Bewahrung der Lehre mit der Ablehnung der päpstlichen Autorität verbunden.
|
Wer ist das irdische Oberhaupt?
| Altorientalen |
|
Assyrische Kirche des Ostens: Mar Gewargis III. Koptisch-orthodoxe Kirche: Papst Tawadros II. Syrisch-orthodoxe Kirche: Mor Ignatius Aphrem II. Karim. Armenisch-orthodoxe Kirche: Karekin Nersissian. Malankara Orthodox-Syrische Kirche: Paulose Mar Thoma. Äthiopisch-orthodoxe Kirche: Abuna Mathias Teklemaryam Asrat.
|
| Orthodoxe |
|
Patriarch von Konstantinopel: Bartholomäus I. Patriarch von Alexandrien: Theodoros II. Patriarch von Antiochien: Johannes X. Yazigi Patriarch von Jerusalem: Theophilos III. Patriarch von Moskau und Russland: Kyrill I. Patriarch von Serbien: Irinej Miroslav Gavrilovic Patriarch von Rumänien: Daniel Patriarch von Bulgarien: Neofit Simeon Nikolov Patriarch v. Georgien: Ilia II. Erekle Gudusauri Siolasvili
|
| Katholiken |
|
Papst Franziskus
|
| Protestanten |
|
In Österreich ist die Kirche A.B. (Lutherische Kirche) mit der Kirche H.B. (Reformierte Kirche) zusammengeschlossen.
Bischof der Evangelischen Kirche Österreichs: Michael Bünker.
Landessuperintendent der Reformierten Kirche Österreichs: Thomas Hennefeld.
|
| Anglikaner |
|
Die jeweiligen britischen Monarchen sind weltliches „Oberhaupt“ der Church of England, also der beiden Kirchenprovinzen mit den Erzbistümern Canterbury und York.
Das Bindeglied aller anglikanischen Kirchen ist die Lambeth-Konferenz, eine alle zehn Jahre zusammentretende Konferenz aller anglikanischen Bischöfe unter dem Ehrenvorsitz des Erzbischofs von Canterbury.
Seit März 2013 ist Justin Welby, amtierender Erzbischof von Canterbury, Primas von ganz England und das geistliche Oberhaupt der Kirche von England sowie Ehrenoberhaupt der anglikanischen Kirchengemeinschaft.
|
Welche Ansätze für die Zukunft werden formuliert?
| Altorientalen |
|
Eine Einigung könnte auf der Grundlage geschehen, dass sich die Kirchen in ihrer jeweiligen Gestalt gegenseitig als rechtgläubig und rechtmäßig anerkennen.
Im Mai 1973 hatten Tawadros’ Vorgänger Schenuda III. und Papst Paul VI. in einem Dokument bekannt, beide Kirchen teilten den gleichen Glauben, trotz unterschiedlicher Formulierungen.
Der päpstliche Primat wird von vielen christlichen Kirchen nicht in seinem „Dass“, wohl aber in seinem „Wie“ in Frage gestellt.
|
| Orthodoxe |
|
Zum Prinzip des Ehrenoberhauptes: Im Rahmen der fünf Patriarchate (Rom, Konstantinopel, Alexandrien, Antiochien und Jerusalem) war der Bischof von Rom im ersten Jahrtausend ein „erster unter gleichen“ (primus inter pares).
Ein Jurisdiktionsanspruch über die gesamte Christenheit ist problematisch.
|
| Katholiken |
|
Das Vatikanum II. sieht im Rückgriff auf Traditionen des ersten Jahrtausends eine Möglichkeit, das Verhältnis von Orts- und Universalkirche neu und ökumenisch verträglich zu bestimmen.
|
| Protestanten |
|
„Würde der Papst das Evangelium nicht mehr behindern, wollte Martin Luther dem Papst die Füße küssen.“
|
| Anglikaner |
|
Bei einer historischen Begegnung im Jahr 1966 haben Papst Paul VI. und Erzbischof Ramsey die Internationale Anglikanisch/Römisch-Katholische Kommission (seit 2011: ARCIC III) errichtet, um einen ernsthaften theologischen Dialog zu führen, der „auf der Grundlage der Evangelien und der altehrwürdigen gemeinsamen Überlieferungen zu jener Einheit in der Wahrheit führen möge, für die Christus gebetet hat“.
|
Teil 1 der Serie:
katholisch / evangelisch: Was sie verbindet, was sie trennt
Teil 2 der Serie:
Verständnis der Heiligen Schrift
Teil 3 der Serie:
Teil 4 der Serie:
Teil 5 der Serie:
Teil 6 der Serie:
Teil 7 der Serie:
Teil 8 der Serie:
Teil 9 der Serie:
Teil 10 - Ende der Serie
weitere Informationen zu
E-Mail-Adresse: redaktion@dersonntag.at